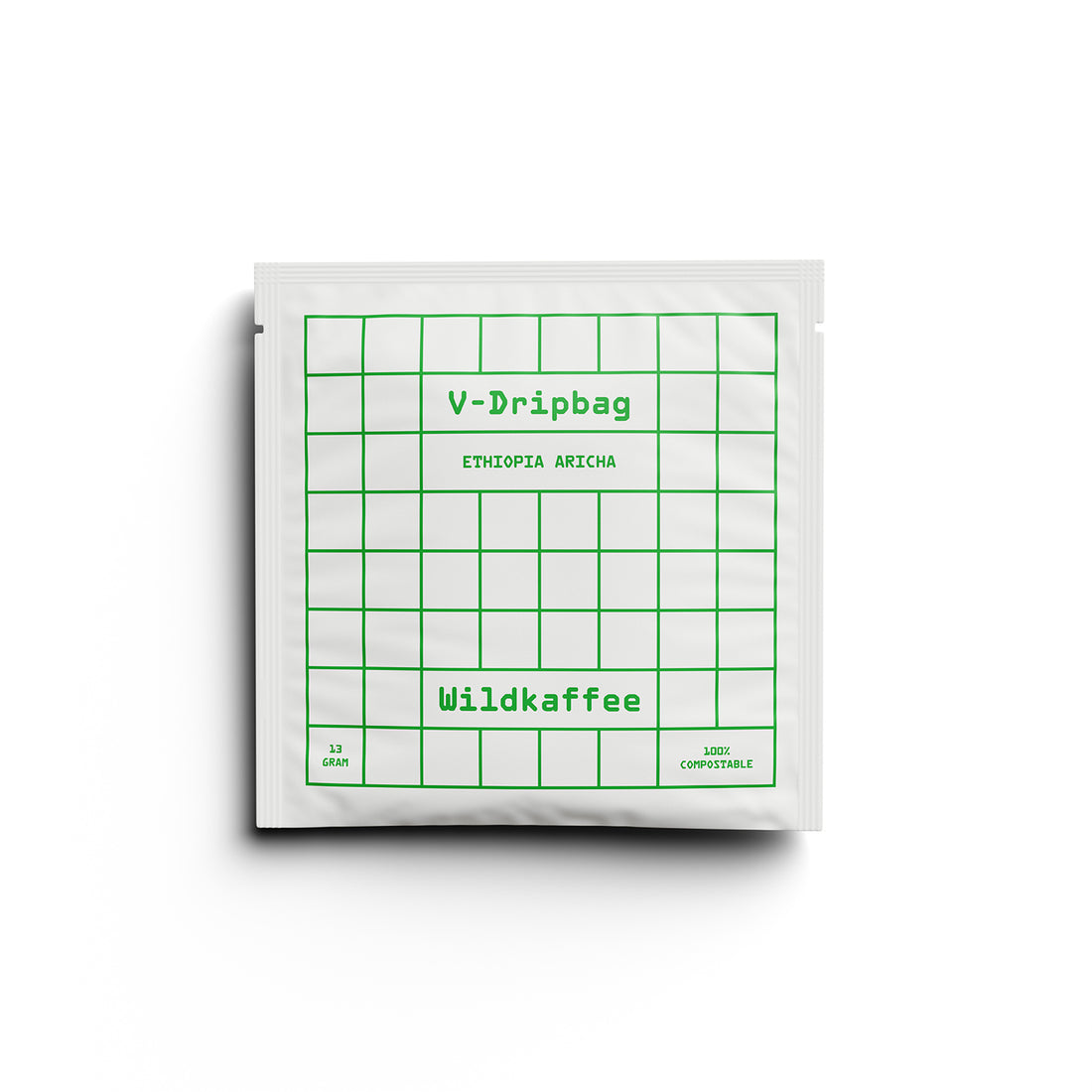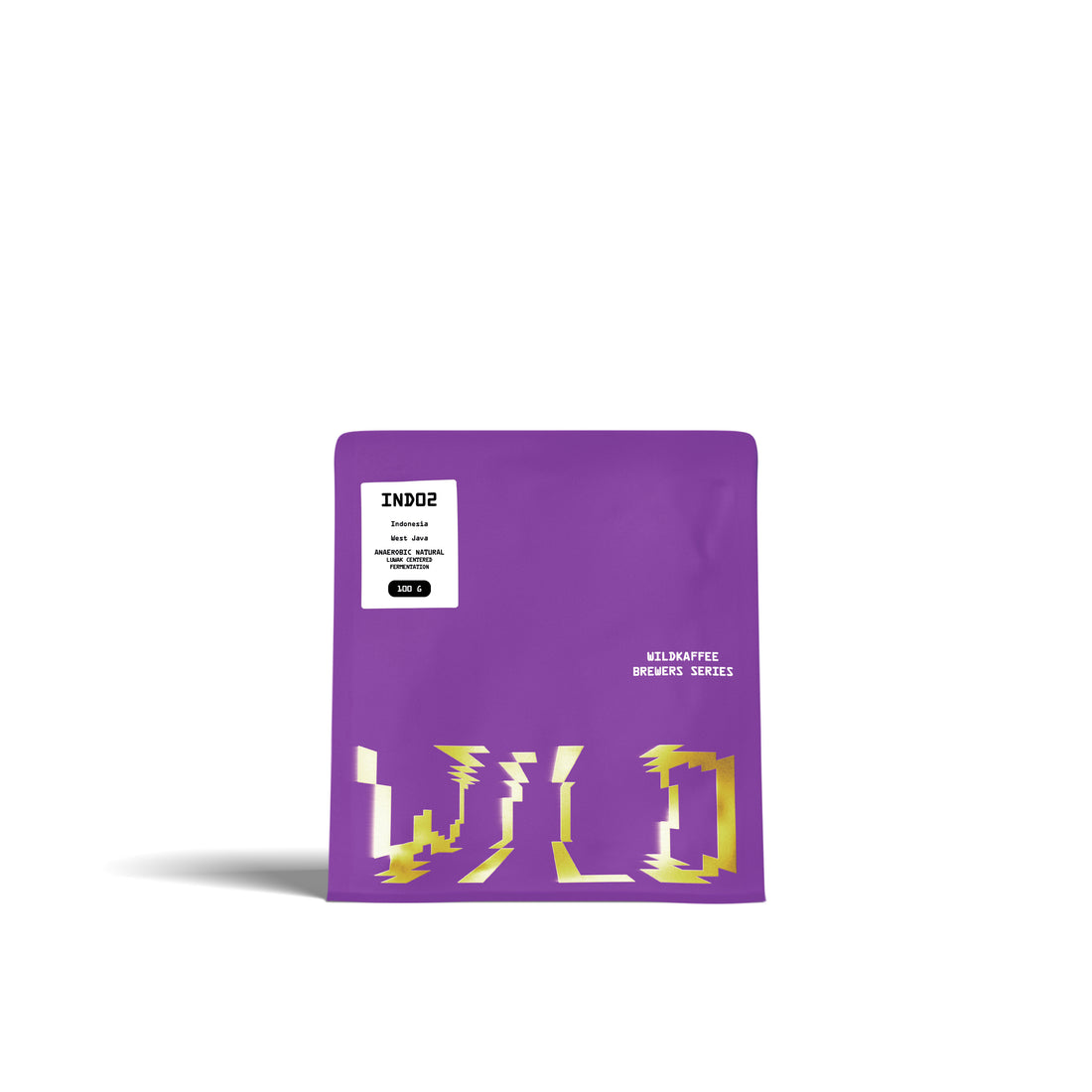Was bedeutet Fair Trade?
Fair Trade ist ein bekanntes, zertifiziertes System mit strengen Richtlinien. Ziel ist es, Kleinbauern faire Preise, soziale Absicherung und ökologische Mindeststandards zu garantieren. Das gilt nicht nur für Kaffeebauern, Fair Trade gibt es auch für viele andere Produzenten von Naturprodukten.
Die Frage ist jedoch viel eher, warum braucht es so etwas wie Fair Trade. Das ist leider so, weil Kaffee immer noch eine an der Börse gehandelte Ware ist. Das führt zu Spekulationen und oft auch zu Dumping-Preisen. Kaffee wird daher vielerorts leider noch auf Quantität und nicht auf Qualität angebaut. Und das hat vor allem für die Produzenten und Arbeiter auf den Kaffeeplantagen negative Folgen: Kinderarbeit, giftige Spritz- und Düngemittel, mangelhafte Ausrüstung, schlechte Bezahlung und Ausbeutung sind nur einige Attribute, die hinter Börsen gehandeltem Kaffee stehen. Fair Trade geht dagegen seit den 1970e-Jahren an.
Kernprinzipien von Fair Trade
- Mindestpreis für Rohkaffee (auch bei fallenden Weltmarktpreisen)
- Prämien für soziale Projekte in der Gemeinschaft
- Kooperativen-Struktur als Voraussetzung
- Verbot von Kinderarbeit & Förderung umweltschonender Anbaumethoden
Vorteile

- Verlässliche Sicherheit für Kaffeebauern
- Transparente Standards und externe Kontrollen
- Weltweit anerkanntes Siegel (z. B. Fairtrade International)
Kritikpunkte
- Aufwendige und kostenintensive Zertifizierung
- Nicht alle Bauern (z. B. Einzelbetriebe) können teilnehmen
- Fixe Standards können wenig Flexibilität bieten
Nachteile von Fair Trade
Eine Sache von Fair Trade ist, dass es ziemlich intransparent ist. Neben dem normalen Siegel gibt es noch 7 weitere Siegel, die von Fair Trade stammen. Dabei variieren auch die enthaltenen fair gehandelten Inhaltsstoffe, die für den Verbraucher, trotz anderem Siegel, schwer ersichtlich sind.
Das genaue System und die Preisbildung von Fairtrade werden von Farmern leider auch dazu genutzt, um günstigeren, etwas minder qualitativen Kaffee mit dem Fairtrade Aufschlag zu verkaufen, während der Kaffee der höheren Qualität auf dem freien Markt verkauft wird. Dabei ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass dieser minderwertigere Kaffee dann in den deutschen Supermärkten landet.
Und das größte Problem von Fair Trade ist die Zertifizierung. Jeder Kaffeebauer, der Fair Trade-Kaffee verkaufen will, muss sich zertifizieren. Die Antragsgebühr beträgt schon allein 525 €, worauf die Erstzertifizierung für 2.300 € folgt. Diese Gebühren fallen dann jährlich an. Diese Summen, gerade für Kaffeefarmer in Schwellenländern eine gehörige Summe Geld und oft nicht stemmbar.
Was ist Direct Trade?
Direct Trade ist kein zertifiziertes System, sondern ein Ansatz, bei dem Röster direkt mit den Kaffeebauern zusammenarbeiten – ohne Zwischenhändler oder große Zertifizierer. Es ist ein Miteinander von Röster und Kaffeebauern. Man lernt sich kennen, besucht sich gegenseitig und arbeitet zusammen daran den Kaffee besser zu machen, um somit höhere Preise zu erzielen. Das führt dazu, dass vor allem die Produzenten mehr Geld für ihr Produkt bekommen, und somit auch verstärkt in ihre Farm und die Anbaumethoden investieren können. Außerdem braucht niemand Angst zu haben, seine Familie nicht ernähren zu können. Wir arbeiten mit vielen Partner-Produzenten bereits seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen.
Merkmale von Direct Trade
- Direkte Beziehungen zwischen Rösterei und Produzenten
- Preisgestaltung unabhängig vom Weltmarkt
- Hoher Qualitätsanspruch (oft Spezialitätenkaffee)
- Fokus auf langfristige Partnerschaften
Vorteile
- Höherer Preis für die Bauern möglich
- Transparenz durch persönliche Beziehungen
- Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus
Herausforderungen
- Keine einheitlichen Standards – jeder Röster definiert Direct Trade anders
- Vertrauen ist zentral, Kontrolle schwierig
- Kein offizielles Siegel, daher Gefahr von Greenwashing
Direkter Handel birgt leider auch Risiken
Auch wenn es im direkten Handel selten böse Absichten gibt (jeder will nur das Beste), kann es trotzdem zu negativen Situationen kommen. Zum Beispiel kann eine Ernte nicht die zugesagte Qualität liefern (Kaffee ist eben ein Naturprodukt und unterliegt Schwankungen). Der Abnehmer könnte dann entweder auf einen niedrigeren Preis drängen oder die Annahme verweigern. Für den Produzenten heißt das, er muss nach anderen Vertriebswegen suchen, um Einnahmeausfälle zu vermeiden. Leider wird direkter Handel manchmal auch als Marketing-Schlagwort verwendet, ohne dass die Unternehmen wirklich direkten Handel betreiben.
Weitere Siegel für fairen oder nachhaltigen Kaffee
Neben Fair Trade und Direct trade gibt es noch viele weitere Siegel, die mehr oder weniger dasselbe Ziel haben: Verbesserung der sozialen Gegebenheiten für Prodzent*innen sowie Nachhaltigkeit und ökologisch produzierte Produkte.
Rainforest Alliance

- Verbindet ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit
- Bauern müssen Umweltstandards einhalten, gerechte Löhne zahlen und keine Kinderarbeit zulassen
- Fokus auf Biodiversität und Klimaschutz
UTZ Certified (seit 2018 Teil von Rainforest Alliance)
- Legt Wert auf Rückverfolgbarkeit, bessere Anbaumethoden und soziale Standards
- Ziel: Professionalisierung der Landwirtschaft
Bio-/Öko-Siegel (z. B. EU-Bio, USDA Organic)
- Nicht direkt „fair“, aber: Kein Einsatz von Pestiziden oder Gentechnik
- Oft gekoppelt mit kleinbäuerlicher Produktion und nachhaltigem Anbau
GEPA / WeltPartner
- Deutscher Fair-Handels-Pionier. Vergibt zwar kein unabhängiges Siegel, aber setzt strenge eigene Standards
- Unterstützt langfristige Handelsbeziehungen, Bildungsprojekte und faire Preise
SPP (Símbolo de Pequeños Productores)
- Eigens von Kleinbauernkooperativen gegründetes Siegel
- Nur für Organisationen von Kleinbauern
- Sehr strikte Fairness-Kriterien
Diese Siegel verfolgen unterschiedliche Schwerpunkte – von sozialen Aspekten über Transparenz bis zu Umweltschutz. Für echten Impact ist oft die Kombination mehrerer Standards entscheidend.
Vergleich: Direct Trade vs. Fair Trade
| KRITERIUM | FAIR TRADE | DIRECT TRADE |
| Zertifizierung | Ja (offizielle Siegel, z. B. Fairtrade) | Nein (individuell organisiert) |
| Mindestpreis | Ja (garantierter Basispreis) | Nein, Preise frei verhandelbar (jedoch meist weit über Weltmarkt-Preis |
| Transparenz | Formal durch Standards | Persönlich durch direkte Beziehungen |
| Teilnahme | Kooperativen mit Zugang zu Zertifizierung | Alleinbetriebe, Kooperativen, Kleinbauern etc. |
| Qualitätsfokus | Sekundär | Primär (Spezialitätenkaffee) |
| Soziale Projekte | Teil der Prämie | Optional, je nach Röster (bei uns z.B. Coffee School Project) |

Was ist nun "besser"?
Es gibt kein pauschales Besser. Beide Modelle haben ihren Platz und ihre Berechtigung:
- Fair Trade ist ideal für strukturschwache Regionen, in denen Kleinbauern ohne direkte Marktzugänge Hilfe brauchen.
- Direct Trade funktioniert besonders gut bei hoher Kaffeequalität, wenn Röster und Bauern langfristig kooperieren. Eignet sich jedoch ebenfalls für strukturschwache Regionen, in denen sich Kleinbauern kaum eine Zertifizierung leisten können.
Tipp für Konsumenten: Achte auf transparente Informationen vom Röster. Gute Anbieter erklären, woher der Kaffee kommt, wie er bezahlt wurde – mit oder ohne Siegel.
Fazit
Direct Trade und Fair Trade sind zwei Wege, um den globalen Kaffeehandel gerechter zu gestalten. Wer nachhaltigen Kaffee trinken will, sollte über das Etikett hinausblicken: Transparenz, Herkunft und fairer Umgang mit Produzenten sind entscheidender als das Label allein. Die Kombination aus beiden Ansätzen – also zertifizierte Sicherheit mit direktem Handel – könnte langfristig der beste Weg sein. Wir persönlich sehen direkten Handel als den einzigen richtigen Weg, denn Zertifizierungen kosten vor allem Kaffeeproduzenten immer noch viel zu viel, was ihren (leider oft schon geringen) Gewinn durch die höheren Ausgaben weiter schmälert.